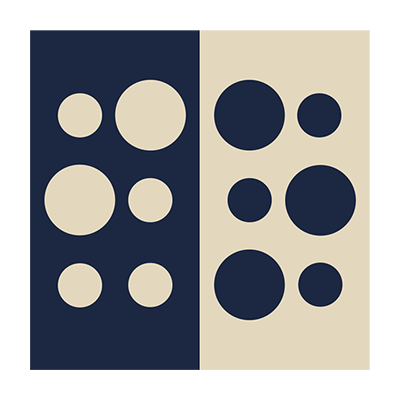Verlust des Sehvermögens als Erwachsener — Was Sie erwartet und wie Sie sich anpassen

Hallo nochmal, Mikhail! Welche emotionalen Reaktionen erleben Erwachsene normalerweise, wenn sie ihr Sehvermögen verlieren?
Ich habe einmal mit einer Patientin gearbeitet, die im Alter von 36 Jahren aufgrund eines seltenen genetischen Syndroms ihre Sehkraft verlor. Sie war eine erfolgreiche, intelligente Frau mit einer soliden Karriere und einer liebevollen Familie. Eines Tages bemerkte sie, dass ihre Sehkraft rapide nachließ. Das Erste, was sie erlebte, war Verzweiflung — eine tiefe Angst: „Was passiert jetzt? Kann ich so weiterleben wie bisher?“ Selbst mit liebevollen Menschen um sie herum — Freunden, Familie, einem unterstützenden Ehemann — fühlte sie sich allein. Alles Vertraute und Stabile in ihrem Leben brach plötzlich zusammen. Selbst einfache Aufgaben wurden zu einer Herausforderung. Sie hat mir erzählt, dass es schon eine beängstigende und anstrengende Herausforderung war, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen, der nur zwei Blocks entfernt war.
Es ist so wichtig, diese Gefühle nicht zu unterdrücken oder vor ihnen davonzulaufen. Man muss ihnen die Möglichkeit geben — und sie dabei unterstützen — sie voll und ganz zu spüren. Dann ist sowohl professionelle als auch persönliche Unterstützung unerlässlich. In ihrem Fall hat sie ihren Mann nicht verlassen, ihre Familie ist ihr nahe geblieben. Obwohl sie ihre Sehkraft nicht vollständig verloren hatte — sie konnte noch immer Licht und Dunkelheit unterscheiden — war es dennoch ein psychischer Schock.
Verändern sich diese Gefühle mit der Zeit?
Ja, das tun sie. Mit der Zeit entwickeln sich Menschen zu mehr Akzeptanz. Ich habe kürzlich eine Sitzung in einem Zentrum für Blinde geleitet, und es war eine lebhafte, fröhliche Gruppe. Die Leute lachten, scherzten und redeten — sie waren völlig miteinander beschäftigt. Aber dorthin zu gelangen, ist ein Prozess. Es dauert nicht Tage oder gar Wochen. Es kann zwischen neun Monaten und zwei Jahren dauern. Die Menschen müssen neu lernen, wie sie funktionieren — sich sicher fortbewegen, zu Hause zurechtfinden, für sich selbst sorgen. Kinder entwickeln diese Fähigkeiten von Geburt an, aber Erwachsene müssen alles neu aufbauen. Es ist eine stressige Transformation.
Ist die Reaktion je nach Alter unterschiedlich?
Absolut. Jüngere Menschen passen sich leichter an. Ihr Geist ist flexibler und sie lernen schneller neue Vorgehensweisen. Dieselbe Frau, die ich erwähnt habe — nachdem sie den größten Teil ihres Sehvermögens verloren hatte, begann sie, Tischtennis für Blinde zu spielen und gewann sogar einen Preis! Ältere Menschen neigen zu einer starreren Persönlichkeit, was die Anpassung erschwert. Dasselbe gilt für die Therapie — je jünger der Klient, desto schneller die Fortschritte.
Welche Phasen der emotionalen Anpassung beobachten Sie normalerweise?
Sie ähneln den Phasen der Trauer: Verdrängung, Wut, Verhandeln, Verzweiflung und Akzeptanz. Sie verlaufen jedoch nicht immer in dieser Reihenfolge. Sie können sich überschneiden. Jemand kann lange wütend sein oder direkt ins Verhandeln einsteigen — „Wenn ich alles richtig mache, kommt mein Augenlicht vielleicht zurück.“ Das sind völlig normale Reaktionen auf eine traumatische Veränderung.
Woran erkennt man, ob jemand in einer dieser Phasen feststeckt?
Es ist meist deutlich zu erkennen. Die Betroffenen wiederholen dieselben Gedanken, kommen nicht weiter, verlieren die Initiative. Das nennt man Grübeln — man denkt ständig und zyklisch über das Problem, ohne eine Lösung zu finden. Es ist, als steckt man in einer Felsspalte fest und könnt seinen Fuß nicht befreien. Dann braucht man einen Anstoß, eine Möglichkeit, die Situation anders zu sehen — mit den Augen eines Therapeuten oder einer Vertrauensperson.
Was ist der Unterschied zwischen schleichendem und plötzlichem Sehverlust?
Schleichender Verlust gibt den Betroffenen Zeit, sich vorzubereiten. Sie werden ärztlich untersucht, erhalten eine Diagnose, haben die Möglichkeit, mit Angehörigen zu sprechen und verarbeiten die Emotionen schrittweise. Ein plötzlicher Verlust — beispielsweise durch eine Verletzung — kann einen unmittelbaren Schock auslösen. Dieser Schock kann zu einer reaktiven Depression oder im Gegenteil zu hektischem, unberechenbarem Verhalten führen. Beides sind Abwehrreaktionen auf überwältigenden Schmerz.
Wie wirken sich familiäre Beziehungen auf die Anpassung aus?
Der Verlust des Sehvermögens macht Sie in gewisser Weise abhängig. Psychisch fallen Betroffene oft zurück — sie fühlen sich wieder wie Kinder. Das belastet die Angehörigen enorm. Ich sehe oft nicht nur Klienten, sondern auch deren Partner und Angehörige in der Therapie. Sie fühlen sich erschöpft, wütend, schuldig — und das ist in Ordnung. Diese Gefühle sind berechtigt. Wichtig ist, Wege zu finden, den geliebten Menschen zu unterstützen, ohne sich selbst zu verlieren.
Welche Unterstützungsformen sind am hilfreichsten?
Praktische Hilfe zu Hause, Gruppentherapie, soziales Engagement — all das. Das Wichtigste ist, sich nicht zu isolieren. Ich arbeite mit Menschen in Projekten wie VOS (der Gesamtrussische Blindenverband), wo sie malen, Sport treiben und reisen. Sie überleben nicht nur — sie blühen auf. Das ist inspirierend.
Was ist, wenn sich jemand immer noch nicht unterstützt fühlt?
Dann ist es wichtig zu prüfen, ob die Unterstützung wirklich fehlt oder ob dieses Gefühl von innen kommt. Manchmal sind Menschen von Hilfe umgeben, fühlen sich aber trotzdem leer — das könnte eine Depression sein. In solchen Fällen konzentrieren wir uns auf unsere inneren Ressourcen. Und manchmal geht es darum, zu akzeptieren, dass sich das Leben verändert hat. Das ist okay.
Welche Ängste sind bei Menschen mit Sehverlust häufig?
Es gibt eine ganze Reihe: Angst vor Ablehnung, vor Einsamkeit, vor dem Tod. Die Menschen werden verletzungsanfälliger — das Überqueren der Straße wird gefährlich. Wenn man sich nicht sicher fühlt, macht sich Angst breit, die unglaublich belastend sein kann.
Und wie wirken sich diese Ängste auf den Alltag aus?
Sie rauben Energie. Man ist ständig im Überlebensmodus, nicht im Wachstumsmodus. Viele Menschen fühlen sich völlig ausgelaugt. Sie brauchen sowohl emotionale als auch praktische Unterstützung.
Welche Techniken helfen Menschen, mit dem Verlust des Sehvermögens umzugehen?
Vieles hilft — körperbasierte Therapien wie authentische Bewegung, kreative Praktiken wie Kunst und Spiele. Der Schlüssel ist eine sichere Umgebung, in der man sich selbst sein, sich frei bewegen, sprechen und Kontakte knüpfen kann. Das reduziert Ängste und stärkt das Selbstvertrauen.
Was passiert mit dem Selbstwertgefühl?
Es sinkt meistens. Die Betroffenen fühlen sich verletzlich und minderwertig. Der Wiederaufbau des Selbstwertgefühls braucht Zeit und viel Unterstützung. Und die Familie spielt dabei eine große Rolle.
Welche psychologischen Barrieren erschweren die soziale Integration?
Einschränkende Überzeugungen — „Ich bin allein“, „Ich kann das nicht“, „Mein Leben ist vorbei“. Diese Überzeugungen sind zwar nicht wahr, fühlen sich aber real an. Glücklicherweise können Menschen sie mit der richtigen Unterstützung oft überwinden.
Können Menschen das alleine verarbeiten?
Es erfordert Reflexion. Man muss sich fragen: „Was, wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle? Was, wenn es einen anderen Weg gibt?“ Doch am Anfang sind die Menschen noch nicht bereit. Sie trauern noch. In dieser Phase brauchen sie einfach nur gehört und gehalten zu werden.
Sind Selbsthilfegruppen hilfreich?
Absolut — sowohl therapeutische als auch informelle. Das Format ist nicht so wichtig wie die richtige Wahl. Manche Menschen lieben Ausdruckskunst, andere brauchen einfach nur Gespräche. Es kommt darauf an, was für den Einzelnen funktioniert.
Gibt es Technologien, die helfen?
Alles, was Menschen das Gefühl gibt: „Ich kann das!“ — sei es adaptive Software, Apps oder Online-Kurse. Digitale Umgebungen ermöglichen Lernen, soziale Kontakte und sogar die Arbeit. Sie helfen Menschen, sich wieder leistungsfähig zu fühlen.
Wie häufig treten Depressionen oder Angstzustände in diesem Zusammenhang auf?
Ziemlich häufig. Angesichts der aktuellen Lage — Pandemie, wirtschaftliche Belastungen, globale Konflikte — ist die Angst bei allen hoch. Für Menschen, die ihr Sehvermögen verlieren, ist sie noch intensiver.
Wie helfen Sie Menschen, motiviert zu bleiben?
Ich nutze Coaching-Techniken. Wir entwickeln eine Zukunftsvision — welches Leben sie sich wünschen. Wir stellen uns ihren Alltag vor, was ihnen Freude bereitet, wie sie sich fühlen. Wenn sie sich emotional mit dieser Zukunft verbinden, entsteht Motivation. Wir erforschen auch Grundwerte: Liebe, Verbundenheit, Freiheit, Freude. Werte geben uns Kraft.
Und was hilft Ihnen, andere effektiver zu unterstützen?
Ehrlich gesagt, ist es eine Mischung aus Empathie und professioneller Neugier. Wenn ich sehe, wie jemand von Verzweiflung zu Erfolg gelangt, erinnert mich das daran, warum ich diese Arbeit mache. Es ist unglaublich erfüllend.
Haben Sie eine Erfolgsgeschichte, die heraussticht?
Ja — das Projekt „Alle Farben der Welt außer Schwarz“. Es bringt blinde und sehbehinderte Menschen zum Malen zusammen. Viele hatten noch nie zuvor einen Pinsel in der Hand. Jetzt gibt es Ausstellungen. Die Besucher merken nicht, dass die Künstler blind sind – und sie sind erstaunt. Diese Anerkennung gibt den Teilnehmern enorm viel Selbstvertrauen. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, was möglich ist.